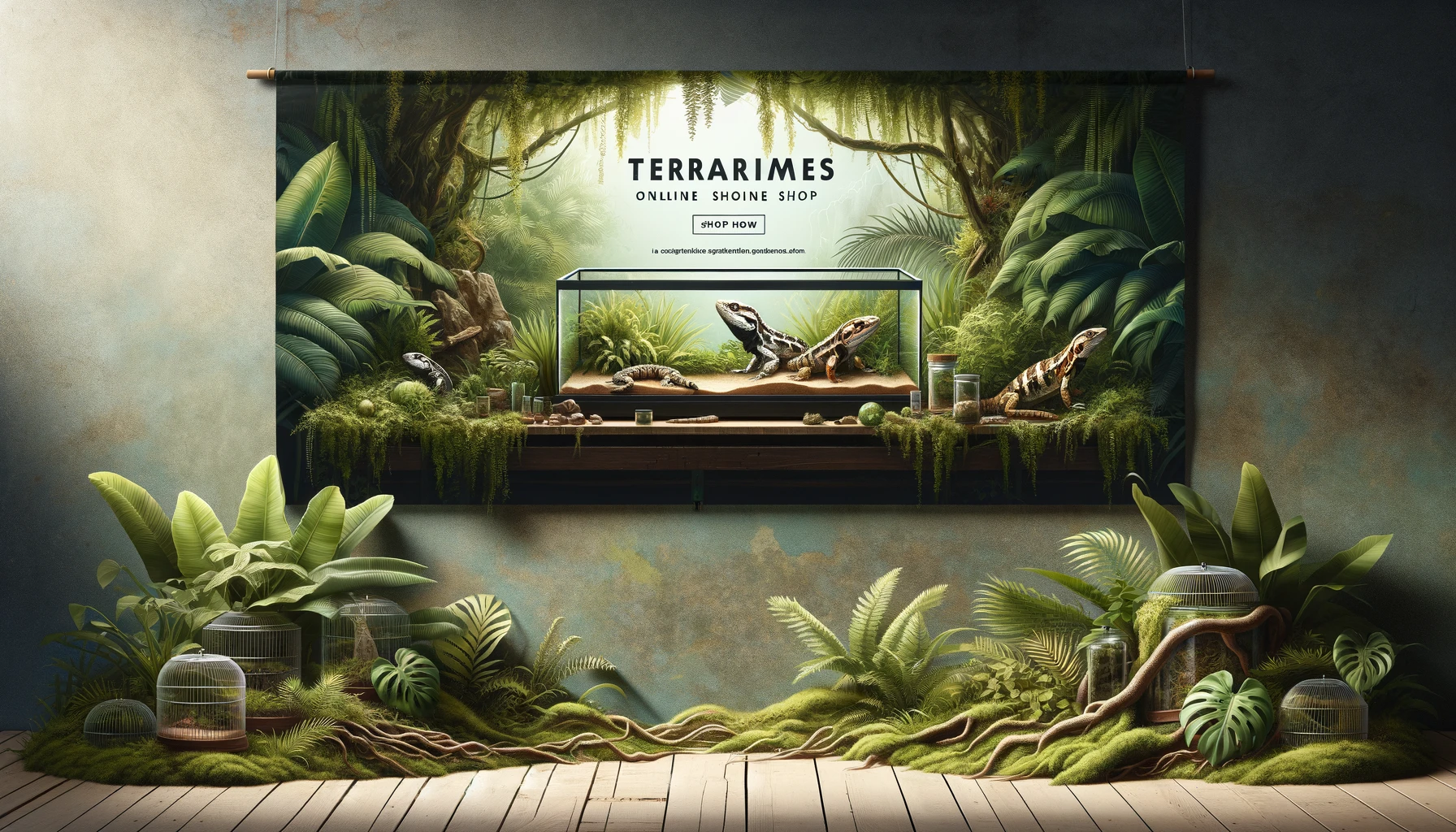Griechische Landschildkröte - Testudo hermanni
Die Griechische Landschildkröte (Testudo hermanni) erfolgreich halten
Die Griechische Landschildkröte, wissenschaftlich Testudo hermanni, gehört zu den beliebtesten Landschildkröten in der Terraristik. Ihr natürlicher Lebensraum erstreckt sich über den Mittelmeerraum – von Spanien und Südfrankreich über Italien bis in die Balkanregion. Als geschützte Art (CITES Anhang II / EU-Anhang A) darf sie nur mit gültigen Papieren erworben werden. Für Anfänger und Familien mit Kindern ist sie ein faszinierendes Haustier, das jedoch besondere Haltungsansprüche und eine sehr lange Lebenserwartung mitbringt. Bei artgerechter Pflege kann eine Griechische Landschildkröte 50 bis 80 Jahre alt werden – in Einzelfällen sogar über 100 Jahre. Diese Pflegeanleitung erklärt ausführlich, wie Sie die Griechische Landschildkröte richtig halten, welches Terrarium oder Freigehege sie benötigt, wie die Ernährung aussieht und worauf Sie beim Kauf achten müssen. Zudem finden Sie einen Steckbrief mit den wichtigsten Fakten und Informationen zu Unterarten, Aussehen, Verhalten, Gesundheit und Zucht.
Aussehen: Wie sieht eine Griechische Landschildkröte aus?
Die Griechische Landschildkröte ist eine kleine bis mittelgroße Landschildkröte mit einer Panzerlänge von meist 15–20 cm, in Ausnahmefällen (insbesondere bei Weibchen der östlichen Unterart) bis zu 28 cm. Auffällig ist ihr gewölbter, ovaler Carapax (Rückenpanzer) mit gelber bis olivfarbener Grundfarbe und kontrastierenden schwarzen Flecken oder Bändern. Jungtiere und viele adulte Tiere zeigen ein strahlend gelb-schwarzes Muster, das im Alter etwas verblassen kann zu helleren Grau- oder Gelbtönen. Ein charakteristisches Merkmal ist ein horniger Dorn (Sporn) am Schwanzende, insbesondere bei Männchen gut ausgeprägt. Männliche Tiere erkennt man zudem an einem längeren, dickeren Schwanz und häufig an einer insgesamt kleineren Körpergröße im Vergleich zu Weibchen. Die Tiere besitzen keine Zähne, sondern einen hornigen, leicht hakigen Schnabel, mit dem sie ihre pflanzliche Nahrung abreißen. Die Vorderbeine sind mit kräftigen Schuppen bedeckt und enden in Krallen (gewöhnlich fünf an den Vorderfüßen). Die Färbung des Kopfes und der Gliedmaßen ist graubraun mit gelblichen Sprenkeln. Insgesamt wirkt die Griechische Landschildkröte sehr robust und urtümlich – ihr “weises” Gesicht und der gepanzerte Körper haben schon Kinder und Erwachsene seit Generationen in ihren Bann gezogen.
Es werden zwei Unterarten unterschieden: die westliche Griechische Landschildkröte (Testudo hermanni hermanni) und die östliche Griechische Landschildkröte (Testudo hermanni boettgeri). Die westliche Unterart kommt in Spanien, Südfrankreich, Korsika, Sardinien und Italien vor und bleibt mit selten über 18 cm Panzerlänge kleiner. Sie zeigt oft ein intensiveres Gelb im Panzer. Die östliche Unterart ist auf dem Balkan (unter anderem in Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Serbien) verbreitet und wird deutlich größer (Weibchen bis 25–28 cm). Beide Unterarten haben auf der Plastron-Unterseite zwei durchgehende schwarze Bänder und unterscheiden sich von anderen Landschildkröten (z. B. Maurische Landschildkröte) durch den geteilten Schwanzschild sowie den Schwanzsporn.
Haltung: Wie halte ich eine Griechische Landschildkröte richtig?
Freilandhaltung – das Optimum für Landschildkröten
Die artgerechteste Form der Haltung für Testudo hermanni ist ein Außengehege im Garten. Im Freiland finden Griechische Landschildkröten reichlich Platz, natürliches Sonnenlicht und Temperaturgefälle, was ihrem Wohlbefinden enorm zugutekommt. Ein großzügiges, sonniges Gehege mit strukturiertem Gelände, Versteckmöglichkeiten und sowohl Sonnen- als auch Schattenplätzen ist ideal. Planen Sie pro erwachsenem Tier mindestens 6–10 m² Fläche ein – mehr ist immer besser, denn in freier Natur legen die Tiere auf Futtersuche Hunderte von Metern pro Tag zurück. Umzäunen Sie das Gehege mit einem mindestens 30–40 cm tief in den Boden reichenden und etwa 30 cm hohen Zaun oder Steinmauer, da Schildkröten gut graben und erstaunlich kletterfreudig sein können. Schützen Sie die Tiere vor Fressfeinden (Ratten, Krähen, Marder etc.), indem Sie bei kleinen Tieren ggf. ein engmaschiges Netz oder Gitter über das Gehege spannen.
Richten Sie im Freiland verschiedene Mikrohabitate ein: Bereiche mit trockener Erde oder Sand zum Graben und Aufwärmen, wilde Wiesenstücke mit Kräutern als Weidefläche und schattige Ecken unter Büschen oder in selbst gebuddelten Erdmulden zur Mittagsruhe. Sehr bewährt hat sich ein Frühbeet oder kleines Gewächshaus im Gehege, das als Schutzhütte dient. Darin können die Tiere nachts oder bei schlechter Witterung unterkommen; ausgestattet mit etwas Heu oder Laub als Bodenmaterial hält es die Nachttemperaturen etwas höher und bietet Geborgenheit. Im Frühjahr hilft ein Frühbeet zudem beim Aufwärmen nach der Winterstarre. Wichtig sind auch flache Wasserstellen: z. B. eine in den Boden eingegrabene flache Schale oder ein Mini-Teich, damit die Schildkröten trinken und bei Bedarf ein wenig baden können. Pflanzen Sie ungiftige, möglichst einheimische Sträucher (Lavendel, Rosmarin, Erdbeeren, Kräuter usw.) ins Gehege – sie spenden Verstecke und dienen teilweise als Futterpflanzen.
Die Freilandhaltung ist in Mitteleuropa von ca. März/April (wenn die Nachttemperaturen dauerhaft über ~5 °C liegen) bis Oktober/November möglich. In dieser Zeit können gesunde adulte Tiere Tag und Nacht draußen bleiben. Bei Temperaturen unter ca. 10 °C werden Landschildkröten inaktiv – an kühleren Frühlingstagen oder kälteren Nächten ist es sinnvoll, die Tiere im Frühbeet oder einer isolierten Schutzhütte zu halten bzw. dort mit einem Wärmestrahler punktuell zu temperieren. An sehr heißen Sommertagen (>35 °C) ziehen sich Schildkröten gerne in schattige Verstecke zurück; sorgen Sie also immer für ausreichend Schattenplätze und Verstecke. Generell gilt: Natursonne ist durch nichts zu ersetzen. Sie liefert UV-Strahlung und Wärme in idealer Form. **Denken Sie jedoch daran, dass auch im Freigehege eine zusätzliche UV-Lampe sinnvoll sein kann**, besonders im zeitigen Frühjahr nach der Winterruhe und für Jungtiere oder Ei-ablagebereite Weibchen. Eine überdachte Ecke mit einem witterungsgeschützten Platz für einen UV-Wärmestrahler ist empfehlenswert. Optimal sind z. B. Metalldampflampen (HID) mit elektronischem Vorschaltgerät, die Wärme und UVB spenden – etwa ein Solar Raptor UV HID-Spotstrahler –, kombiniert mit einem breitstrahlenden UV-Flächenstrahler oder einer UV-Leuchtstoffröhre.
Terrarienhaltung – nur mit passender Technik und Einzelhaltung
So wertvoll die natürliche Freilandhaltung ist, so wird doch häufig zumindest übergangsweise ein Terrarium oder Innengehege benötigt – etwa für Jungtiere, in den Wintermonaten oder wenn kein Garten verfügbar ist. Wichtig: **Ein Terrarium darf für Griechische Landschildkröten niemals zu klein sein.** Ein Terrarium sollte möglichst einer “trockenen Schildkröten-Wohnung” gleichen: flach und mit großer Grundfläche, eher weniger hoch (die Tiere klettern kaum in die Höhe). Für eine junge Landschildkröte rechnet man mit mindestens 120 x 60 cm Grundfläche; erwachsene Tiere benötigen deutlich mehr Platz (2 m² und mehr). Viele Halter bauen daher offene Schildkrötengehege („Schildkrötentische“) anstelle von Glasterrarien, um mehr Fläche zu erhalten und eine gute Belüftung sicherzustellen.
Im Terrarium ist technische Ausrüstung nötig, um Sonne und Klima zu simulieren. Absolut unverzichtbar ist eine starke UVB-Lichtquelle kombiniert mit Wärme. Bewährt hat sich der Einsatz einer UV-Hochdrucklampe, z. B. der Solar Raptor HID-UV-Strahler, der in einer geeigneten Keramikfassung mit Vorschaltgerät betrieben wird und punktuell Sonnenlicht (inklusive UV-A und UV-B) sowie Wärme erzeugt. Als Ergänzung ist eine langformatige UV-Leuchtstoffröhre ideal, um die Fläche breit auszuleuchten – z. B. das Arcadia Lumenize Pro T5 UVB Kit D3 Desert 12% UV-B, das das für Wüstentiere benötigte UV-Spektrum liefert. Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von hellen LED-Lampen für Tageslichthelligkeit, etwa einer Arcadia Jungle Dawn Lumenize LED-Bar, die für starke Beleuchtung sorgt und gleichzeitig Pflanzenwachstum fördert. Diese Kombination – Wärme-UV-Spot, UVB-Röhre und LED-Tageslicht – gewährleistet ein sonnenähnliches Lichtspektrum und ausreichend Helligkeit im Terrarium.
Als Bodengrund im Terrarium eignet sich ein grabfähiges, mäßig feuchtes Substrat, das Feuchtigkeit hält, ohne schimmelig zu werden. Sehr gut bewährt hat sich spezielles Schildkrötensubstrat wie das Lucky Reptile Tortoise Bedding. Dieses Substrat aus natürlichen, humosen Materialien (ohne Sand) bleibt formstabil und fluffig, reguliert die Luftfeuchtigkeit und ist unbedenklich, falls kleine Mengen verschluckt werden. Wichtig ist, dass der Bodengrund nicht staubt und der Schildkröte ermöglicht, sich teilweise einzugraben. Halten Sie einen Teil des Substrats leicht feucht (besonders für Jungtiere), um der Panzerdeformation (Höckerbildung) vorzubeugen – tägliches Sprühen oder Eingießen von Wasser in eine Ecke des Bodens kann helfen, ein lokales Feucht-Versteck zu schaffen, in das sich die Schildkröte bei Bedarf zurückziehen kann (ähnlich einer Erdhöhle).
Die Temperatur im Terrarium sollte einen Gradient bieten: Unter dem Wärmespot darf es lokal 35–40 °C warm werden (Sonnenplatz), während am anderen Ende des Terrariums Zimmertemperatur (~20 °C) herrscht. Nachts kann die Temperatur auf 18–20 °C absinken. Eine Heizmatte am Boden ist nicht geeignet (Verbrennungsgefahr und unnatürliche Wärme von unten); heizen Sie lieber über Spots von oben. Beleuchtungsdauer im Sommer ca. 12–14 Stunden täglich, im Winter (wenn keine Winterstarre gehalten wird) etwas kürzer. **Im Terrarium unbedingt nur Einzelhaltung!** Griechische Landschildkröten sind zwar in freier Wildbahn keine absoluten Einzelgänger, aber auf engem Raum können mehrere Tiere Stress verursachen. Insbesondere zwei Männchen würden rivalisieren, und ein Männchen würde ein einzelnes Weibchen unaufhörlich bedrängen. Daher bei Terrarienhaltung am besten ein Tier pro Gehege halten, oder bei mehreren Weibchen für sehr große Ausweichflächen sorgen.
Eine kleine Wasserschale zum Trinken und gelegentlichen Baden sollte auch im Terrarium ab und an geboten werden. Zudem freuen sich Schildkröten über Unterschlüpfe: z. B. ein halbes Korkröhrenstück, eine kleine Holzkiste als Häuschen oder ein flacher Steinunterstand. Wechseln Sie außerdem zwischen offenen Flächen und Bereichen mit Deko (Steine, Wurzeln, stabile echte oder künstliche Pflanzen), um das Terrarium strukturiert und interessant zu gestalten. So bleibt die Schildkröte aktiv und kann ihrem Erkundungsverhalten nachgehen. Denken Sie daran, Kot und Futterreste täglich zu entfernen und das Substrat bei Bedarf teilweise zu erneuern, um Hygiene zu gewährleisten.
Ernährung: Was fressen Griechische Landschildkröten?
Griechische Landschildkröten sind strikte Pflanzenfresser (Herbivoren). In der Natur machen sie sich über Wildkräuter, Gräser und Blüten her. Eine artgerechte Ernährung in Menschenobhut sollte dieses natürliche Nahrungsangebot nachahmen: **Hauptfutter sollten Wildkräuter und Wiesengräser sein.** Besonders geeignet sind Löwenzahn, Wegerich, Klee, Gänseblümchen, Klettenlabkraut, Disteln, Wilde Malve, Hibiskusblüten, Endivie, Rucola, Kohlblätter (in Maßen) und viele weitere ungedüngte Gartenkräuter. Auch getrocknete kräuterreiche Heumischungen können angeboten werden, da sie einen hohen Rohfaseranteil haben, der für die Verdauung wichtig ist. Im Sommer können Sie täglich frische Wiesenkräuter anbieten; im Winter helfen selbstgezogene Wildkräuter im Indoor-Gewächshaus oder gute Heuprodukte.
Auf dem Speiseplan sollten **keine** tierischen Proteine stehen – im Gegensatz zu manchen Wasserschildkröten benötigen Landschildkröten keinerlei Fleisch oder Insekten. Nur in Ausnahmefällen fressen sie in freier Wildbahn mal Aas oder Schnecken, doch als Halter sollte man das nicht verfüttern. Auch Obst ist bei mediterranen Landschildkröten nur als kleiner Leckerbissen zu betrachten: Wegen des hohen Zuckergehalts und der falschen Bakterienflora im Darm kann zu viel Obst zu Durchfall und Darmproblemen führen. Ein sehr kleines Stück reife Feige, Erdbeere oder Hibiskusblüte gelegentlich schadet nicht, aber generell gilt: **Lieber Wildkräuter statt Obst**. Gemüse wie Gurke, Zucchini oder Karotte wird zwar gefressen, hat aber relativ wenig Nährwert. Besser sind dunkelgrüne Blattgemüse (Endivie, Romana-Salat, Chicorée) und vor allem Wildpflanzen.
Da in unseren Breiten das natürliche Futter nicht ganz die gleichen Nährstoffprofile hat wie in der Mittelmeer-Macchie, empfiehlt sich die Gabe von Kalzium und Vitaminpräparaten. Stellen Sie Ihrer Schildkröte immer eine Kalziumquelle zur Verfügung. Bewährt hat sich ein Stück Sepiaschale (vom Tintenfisch) im Gehege, an dem die Tiere bei Bedarf nagen können. Alternativ können Sie zerriebene Sepia oder Kalziumpulver über das Futter streuen. Aus dem Fachhandel gibt es z. B. Sepia Crushed (fein gemahlene Sepiaschale), die sich leicht dosieren und über Grünfutter geben lässt. Vitaminpräparate mit Vitamin D3 können in Abständen von ein bis zwei Wochen leicht über das Futter gestäubt werden, insbesondere wenn die natürliche UV-Licht-Versorgung zeitweise eingeschränkt ist.
Als Zusatzfutter für Zeiten, in denen keine frischen Wildkräuter verfügbar sind, können Sie auf spezielle Fertigfutter für Landschildkröten zurückgreifen. Diese sollten jedoch immer nur ergänzend und in Maßen gefüttert werden. Empfehlenswert sind Produkte, die einen hohen Rohfaseranteil und natürliche Zutaten haben. Ein Beispiel sind die Lucky Reptile Herp Diner Herb Cobs – das sind Pellets aus Wiesenheu und Kräutern, die wichtige Ballaststoffe und Vitamine liefern. Sie können trocken angeboten oder in Wasser etwas eingeweicht werden, um einen Kräuterbrei zu erzeugen. Solche Produkte sind praktisch, um außerhalb der Vegetationsperiode für Abwechslung und Nährstoffversorgung zu sorgen. Dennoch sollte der Großteil der Ernährung immer aus frischem Grün bestehen.
Frisches Trinkwasser muss täglich bereitgestellt werden. Idealerweise verwenden Sie eine flache Schale, in die die Schildkröte auch hineinsteigen kann – viele Landschildkröten trinken, indem sie sich mit dem Vorderkörper ins Wasser stellen und Wasser aufnehmen. Wechseln Sie das Wasser täglich und sorgen Sie dafür, dass es nicht in der prallen Sonne verdunstet. **Fütterungshinweis:** Füttern Sie eher morgens, nachdem die Tiere sich aufgewärmt haben. In der Mittagshitze fressen Schildkröten oft weniger und ruhen lieber. Abends sollte kein frisches, feuchtes Futter mehr im Gehege liegen, um keine Schnecken oder Insekten anzulocken. Entfernen Sie nicht gefressene Futterreste spätestens am nächsten Tag, damit sie nicht verderben.
Verhalten: Wie aktiv sind Landschildkröten?
Griechische Landschildkröten sind dämmerungs- und tagaktive Reptilien. In den frühen Morgenstunden sonnen sie sich ausgiebig, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Man kann beobachten, wie sie sich zur Sonne ausrichten, die Gliedmaßen von sich strecken und Wärme tanken – diese “Sonnenmeditation” kann 20–30 Minuten dauern. Sobald sie warm sind, beginnen sie umherzuwandern und nach Futter zu suchen. Dabei folgen sie ihrem hervorragenden Geruchssinn, mit dem sie geeignete Pflanzen aufspüren. Schildkröten wirken zwar langsam, legen aber im Laufe eines Tages erstaunliche Strecken zurück, wenn genügend Platz vorhanden ist. Zwischendurch wird immer wieder gefressen und erneut gebaskt.
In der Mittagshitze ziehen sich die Tiere oft in den Schatten zurück und ruhen – dieses Verhalten nennt man auch Mittagssiesta. Sie graben sich flache Mulden unter Büschen oder nutzen vorhandene Verstecke, um sich vor Überhitzung zu schützen. Am späten Nachmittag werden sie wieder aktiver, kommen aus den Verstecken hervor und fressen ein zweites Mal ausgiebiger, bevor sie sich gegen Abend einen Schlafplatz suchen. Nachts schlafen Landschildkröten an geschützten Orten, meist halb eingebuddelt unter Laub oder in Erdmulden. Sie haben einen ausgeprägten Orientierungssinn und kehren oft zu bestimmten Lieblingsplätzen zurück.
Generell sind Griechische Landschildkröten keine sozialen Tiere in dem Sinne, dass sie aktive Interaktionen oder Familienverbände hätten. Allerdings vertragen sich mehrere Weibchen unter ausreichend Platz oft gut. Männchen hingegen zeigen untereinander Territorialverhalten: Sie können aggressiv werden, sich rammen und beißen. Auch gegenüber Weibchen zeigen Männchen vor allem zur Paarungszeit ein raues Werbeverhalten – sie verfolgen das Weibchen, stoßen Zischlaute aus, rammen den Panzer des Weibchens und versuchen aufzusitzen. Diese Aktivitäten können für ein einzelnes Weibchen sehr stressig werden. Deshalb gilt: **ein Männchen nur mit mehreren Weibchen halten (damit sich die Aufmerksamkeit verteilt)** oder am besten gleich Geschlechtertrennung, falls keine Zuchtabsicht besteht.
Für den Halter wirken Landschildkröten auf den ersten Blick vielleicht weniger “interaktiv” als etwa ein Hund oder ein Meerschweinchen. Doch mit der Zeit erkennen sie die individuellen Verhaltensweisen: Manche Schildkröten werden mit der Zeit recht zutraulich, fressen aus der Hand und kommen neugierig angeschnauft, wenn man das Gehege betritt – meist in Erwartung von Futter. Kinder sollten lernen, die Schildkröte ruhig zu beobachten statt sie ständig hochzuheben. Die Tiere reagieren auf häufiges Umhertragen und Hantieren mit Stress, was durch Einziehen in den Panzer und Zischen signalisiert wird. Als Beobachtungstiere sind sie jedoch großartig: Ihr gemächlicher Gang, das Knabbern an Löwenzahn oder das eifrige Graben einer Kuhle sind spannende Naturschauspiele im Kleinen. Zudem können Kinder Verantwortung übernehmen, indem sie z. B. täglich Futter sammeln, Wasser wechseln und das Tier versorgen – immer mit Unterstützung der Erwachsenen.
Gesundheit: Wie alt kann eine Griechische Landschildkröte werden und worauf ist zu achten?
Griechische Landschildkröten sind bei guter Haltung erstaunlich langlebig. Viele Exemplare erreichen 40–60 Jahre, und nicht selten werden offiziell über 80 Jahre dokumentiert. In der Literatur gibt es Hinweise auf einzelne Tiere, die über 100 Jahre alt wurden. Diese enorme Lebenserwartung bedeutet, dass die Anschaffung einer Schildkröte eine sehr langfristige Verantwortung ist – unter Umständen wird die Schildkröte die Kinder, die sie aufziehen, überleben und später von der nächsten Generation weitergepflegt werden müssen.
Wichtig für die Gesundheit der Tiere ist neben richtiger Ernährung vor allem die Möglichkeit zum Halten einer Winterruhe. In der Natur halten Testudo hermanni etwa von Oktober bis März eine Winterstarre (Hibernation), vergraben in Laub oder Erdboden. Auch in menschlicher Obhut sollten die Tiere jedes Jahr diese Winterruhe durchführen, da sie für den Stoffwechsel und die Lebenserwartung entscheidend ist. In den ersten ein bis zwei Lebensjahren lassen manche Halter die Jungtiere nur verkürzt oder gar nicht überwintern, um Wachstum zu beobachten – langfristig aber ist eine Winterstarre von ca. 8–12 Wochen ratsam. Dazu überwintert man die Schildkröte kühl (etwa 4–6 °C) in feuchtem Substrat, beispielsweise in einer mit Laub gefüllten Kiste im Kühlschrank oder einem geeigneten Klimaschrank. Im Freiland können robuste adulte Tiere auch im Boden überwintern, sofern sie vor Nässe und Frost geschützt sind (kalter, frostsicherer Keller oder Frühbeet mit Bodenheizung). Vor und nach der Winterruhe müssen die Schildkröten entsprechend vorbereitet werden (Fastenzeit vorab, langsames Aufwärmen danach). Ist die Winterstarre erfolgreich, kommt die Schildkröte gestärkt ins Frühjahr und setzt ihr Wachstum harmonisch fort – das Ausbleiben der Starre kann dagegen auf Dauer zu Organschäden, Wachstumsstörungen und verminderter Lebenserwartung führen.
Ein häufiger Aspekt der Gesundheitsvorsorge ist die Parasitenkontrolle. Viele Schildkröten haben Darmparasiten (Würmer), die in geringer Zahl normal sind. Übermäßiger Befall jedoch kann das Tier schwächen. Daher ist es sinnvoll, Kotproben (insbesondere von neu erworbenen Tieren oder nach der Winterruhe) vom reptilienkundigen Tierarzt untersuchen zu lassen. Falls nötig, wird eine Wurmkur verabreicht. Anzeichen für Probleme können Durchfall, sehr übelriechender Kot oder starkes Gewichtverlieren sein.
Weitere Gesundheitsprobleme entstehen meist durch Haltungsfehler: Ein Mangel an UV-Licht und Kalzium führt zu Rachitis und Panzererweichung (weicher, deformierter Panzer, der Höcker bildet – sogenanntes “Pyramiding”). Achten Sie deshalb unbedingt auf genügend UVB-Licht und Kalziumversorgung, insbesondere bei Jungtieren, deren Panzer noch wächst. Eine zu eiweißreiche Nahrung (z. B. Katzenfutter, was fälschlicherweise früher teils gegeben wurde) führt zu Nierenschäden und Deformationen – also strikt vermeiden. Eine dauerhaft zu trockene Terrarienhaltung ohne Rückzugsfeuchte kann zu Atemwegsproblemen und Panzeranomalien führen; auf der anderen Seite verursacht staubig-feuchte Haltung oder verdrecktes Milieu schnell Lungenentzündungen oder Augenentzündungen. Halten Sie daher Ihr Terrarium sauber und gut belüftet.
Im Sommer können Schildkröten im Freien einen leichten Schnupfen entwickeln (Ausfluss aus der Nase, Niesen), oft bedingt durch Temperaturschwankungen oder Zugluft. Meist reguliert sich das durch Wärme und korrekte Haltung wieder. Sollte ein Tier jedoch apathisch werden, die Augen geschlossen halten, keinen Appetit haben oder auffällige Schwellungen am Körper zeigen, ist ein reptilienkundiger Tierarzt aufzusuchen. Griechische Landschildkröten sind im Grunde robuste Tiere, wenn man ihre Bedürfnisse erfüllt. Viele Halter erleben es, dass ihre Schildkröten jahrzehntelang ohne ernsthafte Krankheit bleiben. Dennoch lohnt es sich, ein kleines Buch über Schildkrötenkrankheiten zur Hand zu haben und im Zweifel frühzeitig fachkundigen Rat einzuholen.
Ein Wort noch zur Hitze: Bei extrem heißem Wetter (über ~38 °C in der Sonne) können auch Schildkröten überhitzen. Stellen Sie sicher, dass im Gehege immer kühlere, feuchte Bodenzonen vorhanden sind oder besprühen Sie an heißen Tagen morgens das Gehege leicht mit Wasser. Beobachten Sie Ihre Tiere – hecheln (schnelles Atmen mit geöffnetem Maul) und Flachbleiben im Schatten sind Zeichen, dass es sehr warm ist. In der Regel regulieren die Schildkröten das aber gut selbst, wenn ihnen entsprechende Gehegebedingungen geboten werden.
Zucht: Wie viele Eier legen Griechische Landschildkröten?
Die Nachzucht Griechischer Landschildkröten ist möglich, aber erfordert Erfahrung und die richtigen Rahmenbedingungen. Geschlechtsreif werden Männchen etwa mit 5–7 Jahren (Panzerlänge ca. 10–12 cm) und Weibchen mit 8–10 Jahren (Panzerlänge ca. 15 cm) – dies variiert je nach Wachstum und Gesundheit. In menschlicher Obhut kann es teils auch später sein. Zur Paarungszeit im Frühling, direkt nach der Winterstarre, werden die Männchen aktiv und suchen die Nähe der Weibchen. Die Paarung geht – wie erwähnt – ziemlich ruppig vonstatten: Das Männchen umkreist das Weibchen, rammt den Panzer seitlich und beißt ins Bein oder an den Panzer, um das Weibchen zum Stehenbleiben zu bewegen, und besteigt es dann. Dabei gibt das Männchen oft quietschende Laute von sich. Dieses Verhalten kann für unerfahrene Halter erschreckend wirken, ist aber normal. Wichtig ist, das Weibchen danach Ruhe finden zu lassen und es nicht dauerhaft einzeln von einem Männchen bedrängen zu lassen.
Ein paar Wochen nach erfolgreicher Paarung beginnt das trächtige Weibchen, einen geeigneten Eiablageplatz zu suchen. Meist ab Mai bis Juli werden die Eier abgelegt. Der Eiablageplatz ist idealerweise ein sonniges, sandig-lockeres Stück Erde. Das Weibchen gräbt mit den Hinterbeinen eine flaschenförmige Grube (ca. 10–12 cm tief) und legt darin ihre Eier ab. Griechische Landschildkröten legen pro Gelege typischerweise zwischen 3 und 8 Eier – je nach Größe und Alter des Weibchens. In seltenen Fällen können es bis zu 11 oder 12 Eier sein. Meist kommen pro Saison zwei Gelege vor (ein erstes im späten Frühjahr, ein zweites einige Wochen später); gelegentlich auch ein drittes, wenn die Bedingungen und das Weibchen sehr fit sind. Zwischen den Gelegen liegen etwa 3–5 Wochen. Die Eier sind weißlich und haben eine ledrige Schale. Nach der Ablage bedeckt das Weibchen die Grube sorgfältig mit Erde und klopft den Boden mit dem Plastron fest. Danach kümmert es sich nicht weiter um das Gelege.
In unseren Breitengraden ist eine natürlich Inkubation im Freiland schwierig (zu feucht und unbeständig). Daher werden die Eier meist entnommen und im Inkubator bei konstanten Temperaturen ausgebrütet. Die **Inkubationsdauer** beträgt rund 55–70 Tage, abhängig von der Temperatur. Bei ca. 32 °C entwickeln sich die Eier schneller (um 55–60 Tage) und es schlüpfen überwiegend Weibchen, bei ca. 28 °C dauert es länger (um 70 Tage) und es schlüpfen mehr Männchen – wie viele Reptilien haben Hermannschildkröten eine temperaturabhängige Geschlechtsbestimmung. Eine mittlere Inkubationstemperatur von etwa 30–31 °C führt zu einem gemischten Geschlechtsverhältnis. Die Luftfeuchtigkeit im Inkubator sollte moderat sein (etwa 70%). Am einfachsten brütet man die Eier in Vermiculite oder Perlite aus, indem man sie darin halb vergräbt und die Brutbox leicht feucht hält.
Wenn die Babys nach erfolgreicher Inkubation schlüpfen, brechen sie die Eischale mit dem sogenannten Eizahn auf der Schnauzenspitze auf. Die Jungtiere haben anfangs oft noch einen kleinen Dottersackrest am Bauch, der sich aber innerhalb weniger Tage vollständig zurückbildet – in dieser Zeit bleiben sie idealerweise im Inkubator oder in einer separaten Box auf feuchtem Küchenpapier, um Infektionen am Nabel vorzubeugen. Schon nach wenigen Tagen fressen die Mini-Schildkröten ihre ersten Kräuter. Die Aufzucht der Jungtiere erfolgt am besten in einem gut strukturierten Terrarium mit Wärme- und UV-Lampen, ähnlich wie bei den Erwachsenen, jedoch mit besonderem Augenmerk auf ausreichend Feuchtigkeit, um ein glattes Panzerwachstum zu fördern (tägliches Besprühen, feuchte Verstecke). Junge Schildkröten können – und sollen – bereits im ersten Winter eine verkürzte Winterruhe von 4–8 Wochen halten, da dies ihr Stoffwechsel und Wachstum positiv beeinflusst.
Die Nachzucht von Testudo hermanni unterliegt gesetzlichen Bestimmungen. In Deutschland und den meisten EU-Ländern müssen Schlüpflinge binnen einiger Tage bei der Naturschutzbehörde gemeldet werden. Die Jungtiere erhalten Dokumente (CITES-Bescheinigung) und oft auch eine Kennzeichnung (Mikrochip oder Fotodokumentation), sobald sie groß genug sind. Diese Formalitäten sind wichtig, um die Legalität der Tiere nachzuweisen und Wildfänge zu unterbinden. Überlegen Sie also gut, ob Sie züchten möchten – es bedeutet Verantwortung für die kleinen Schildkröten über Jahre hinweg, bis man sie ggf. in gute Hände vermittelt. Angesichts der langen Lebensdauer sollte die Zucht nur erfolgen, wenn man bereit ist, sich im Zweifel auch sehr lange um den Nachwuchs zu kümmern oder geeignete Plätze findet.
Eine Griechische Landschildkröte kaufen: Darauf müssen Sie achten
Die Anschaffung einer Griechischen Landschildkröte will gut überlegt sein. Aufgrund ihres Schutzstatus (WA Anhang A in der EU) dürfen diese Tiere nur mit entsprechenden Papieren verkauft oder weitergegeben werden. Kaufen Sie also **ausschließlich Nachzuchten** von seriösen Züchtern oder im Tierfachhandel mit Herkunftsnachweis. Lassen Sie sich die CITES-Bescheinigung zeigen – jedes Tier hat ein individuelles Dokument. Oft werden Jungtiere mit Fotodokumentation und einer EG-Bescheinigung abgegeben; bei adulten Tieren ist meist ein Mikrochip unter der Haut, der in den Papieren vermerkt ist. Prüfen Sie, ob alle Angaben stimmig sind.
Achten Sie beim Kauf auf den Gesundheitszustand der Schildkröte: Ein gesundes Jungtier hat klare, offene Augen, ein fest geschlossenes Maul (kein Speichel oder Nasenausfluss), bewegt sich neugierig und zieht bei Berührung Kopf und Gliedmaßen kräftig ein. Der Panzer sollte fest und ohne weiche Stellen sein (bei Babys ist der Bauchpanzer noch etwas nachgiebig, das ist normal, aber er darf nicht schwammig sein). Verformungen oder starke Höcker auf dem Panzer deuten auf Haltungsfehler in der Aufzucht (z. B. zu trocken oder falsche Ernährung) hin. Ein paar kleine Höcker können vorkommen, aber insgesamt sollte der Panzer eine gleichmäßige Wölbung haben. Das Gewicht in Relation zur Größe kann man mit dem sogenannten Stockmaß prüfen (es gibt Tabellen, z. B. nach Jackson Ratio). Viele Züchter wiegen ihre Jungtiere regelmäßig – scheuen Sie sich nicht zu fragen, ob das Tier gut gewachsen ist.
Fragen Sie den Verkäufer nach den Haltungsbedingungen: Hat die Jungtiere bereits eine Winterstarre gehalten? (Das wäre ein Pluspunkt, weil es auf Robustheit und korrekte Pflege hindeutet.) Wurde UV-Licht angeboten, welche Nahrung gab es? Ein verantwortungsvoller Züchter wird Ihnen all diese Fragen gern beantworten und auch Tipps für die weitere Haltung geben. Seriöse Anbieter verkaufen in der Regel nicht in den Wintermonaten, es sei denn, das Tier hat nicht starren können – Jungtiere sollten idealerweise mindestens einmal überwintert haben, bevor sie den Besitzer wechseln.
Überlegen Sie vor dem Kauf, wer die Schildkröte versorgen wird und wo sie in 30, 50 oder sogar 80 Jahren sein wird. Diese Tiere können ein Menschenleben begleiten. Wenn Sie Kinder haben, bedenken Sie, dass die Hauptverantwortung immer bei den Erwachsenen liegen muss. Kinder können tolle Helfer sein und viel von der Tierpflege lernen, aber Urlaubsbetreuung, Tierarztbesuche und langfristige Planung obliegen den Eltern. Griechische Landschildkröten sind keine Kuscheltiere – sie eignen sich nicht zum Spielen oder Herumtragen. Bringen Sie Ihren Kindern bei, das Tier mit Respekt zu behandeln, seinen Panzer nicht zu beklopfen und es nicht ohne Grund aus seiner Umgebung herauszuheben. Bei ruhigem Umgang werden Schildkröten zutraulich und lassen sich sogar am Kopf oder Panzer leicht streicheln, aber jedes Tier hat da seinen eigenen Charakter.
Die Erstausstattung für eine Landschildkröte ist mit Kosten verbunden: Terrarium oder Freigehege-Material, UV-Lampen, Wärmestrahler, Vorschaltgeräte, Zeitschaltuhren, Thermo-/Hygrometer, Bodengrund, Verstecke etc. Planen Sie einige hundert Euro dafür ein – sparen Sie nicht an der Beleuchtung, denn diese ist das Herzstück der Innenhaltung. Im laufenden Unterhalt sind Schildkröten relativ günstig: Sie fressen Wildkräuter, die man oft kostenfrei sammeln kann, dazu kommen Stromkosten für die Beleuchtung und ab und an neue Leuchtmittel oder Ergänzungsfutter. Tierarztkosten halten sich bei robusten Tieren in Grenzen, beschränken sich meist auf Kotuntersuchungen oder gelegentliche Checks.
Wenn all diese Punkte bedacht sind und Sie sich entschlossen haben, eine Griechische Landschildkröte bei sich aufzunehmen, steht einem spannenden Hobby nichts mehr im Wege. Beobachten Sie Ihr Tier täglich – Schildkröten haben subtile Verhaltensweisen, aber mit der Zeit erkennt man Stimmungen und Vorlieben. Es ist eine erfüllende Aufgabe, ein Stück mediterrane Natur im heimischen Garten oder Terrarium zu pflegen und damit aktiv zum Arterhalt beizutragen. Im nächsten Abschnitt finden Sie einen übersichtlichen Steckbrief mit den wichtigsten Daten zu Ihrer Griechischen Landschildkröte.
Steckbrief zur Griechischen Landschildkröte
- Wissenschaftlicher Name: Testudo hermanni (Gmelin, 1789)
- Familie: Landschildkröten (Testudinidae)
- Unterarten: Westliche Griechische Landschildkröte (T. h. hermanni) und Östliche Griechische Landschildkröte (T. h. boettgeri)
- Verbreitung: Mittelmeerraum (Westliche Unterart in Ost-Spanien, Südfrankreich, Balearen, Korsika, Sardinien, Italien; Östliche Unterart Balkanhalbinsel von Slowenien und Kroatien bis Griechenland und europäische Türkei)
- Lebensraum: Trockene, warme Habitate: lichte Wälder, Macchie, Garrigue, Steinheiden, Wiesen und Kulturland mit Buschwerk
- Größe: Männchen ca. 15–20 cm Panzerlänge, Weibchen 18–28 cm (je nach Unterart und Alter)
- Gewicht: Adulte Tiere meist 1–2 kg (große Weibchen östlicher Unterart bis 3 kg)
- Lebenserwartung: 50–80 Jahre üblich, in Ausnahmefällen über 100 Jahre
- Aktivität: Tagaktiv (dämmerungsaktiv morgens und spätnachmittags); hält Winterstarre ca. 3–5 Monate im Jahr
- Ernährung: Herbivor (reiner Pflanzenfresser); frisst Wildkräuter, Gräser, Blüten, gelegentlich sukkulente Früchte; hoher Rohfaserbedarf
- Geschlechtsreife: Männchen ca. ab 5–7 Jahren, Weibchen ab ca. 8–10 Jahren (je nach Wachstum und Größe)
- Fortpflanzung: Paarungszeit im Frühjahr nach der Winterruhe; Eiablage meist Mai–Juli in 1–3 Gelegen mit je 2–8 (max. ~12) Eiern Inkubationszeit ~55–70 Tage bei 28–32 °C; Temperatur beeinflusst Geschlecht der Jungtiere (höhere Temp = mehr Weibchen)
- Schutzstatus: Streng geschützt (WA Anhang II / EU-Anhang A); Handel nur mit CITES-Papieren; Nachzuchten meldepflichtig
Mit diesem Wissen und der richtigen Ausstattung steht einer erfolgreichen Haltung Ihrer Griechischen Landschildkröte nichts mehr im Wege. Sie werden viele Jahre Freude an dem faszinierenden Panzertier haben und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung dieser geschützten Art leisten. Viel Erfolg und Freude mit Ihrer Schildkröte!